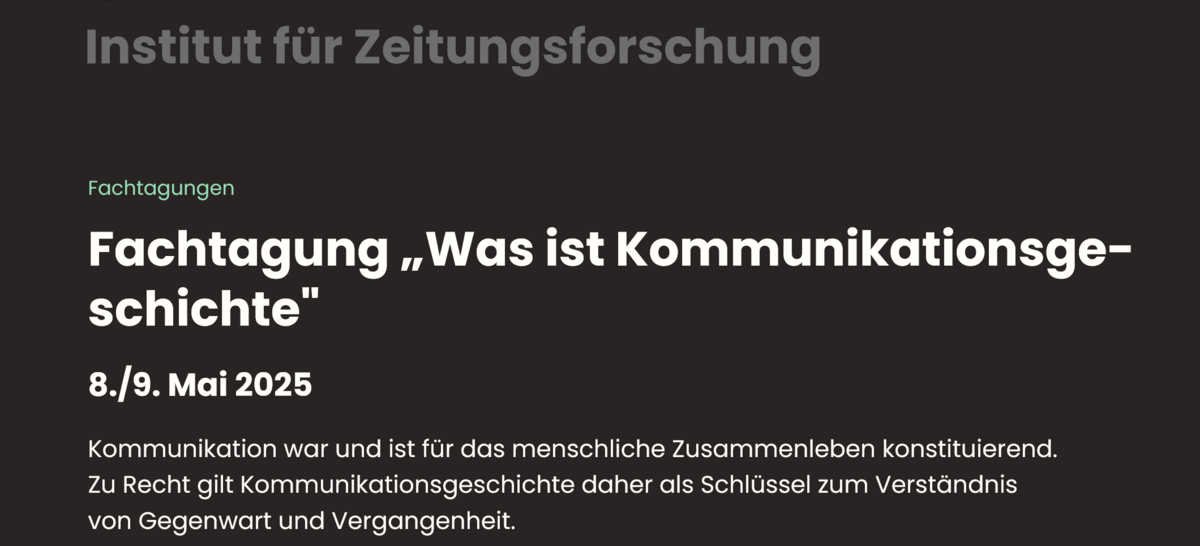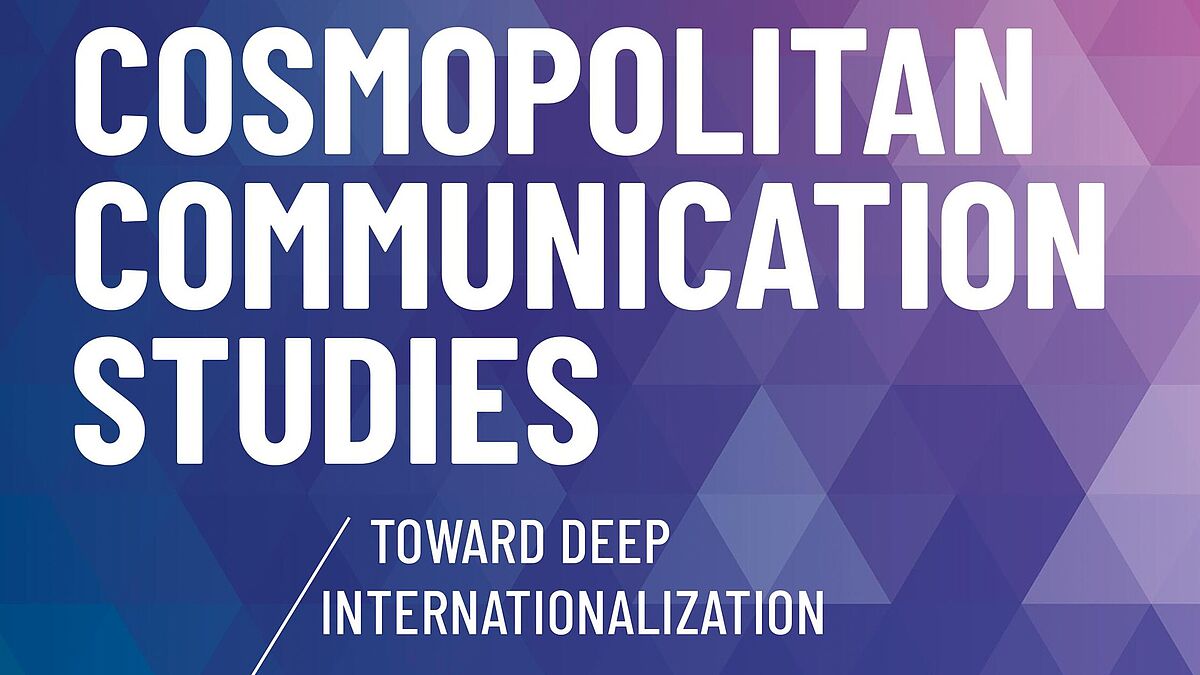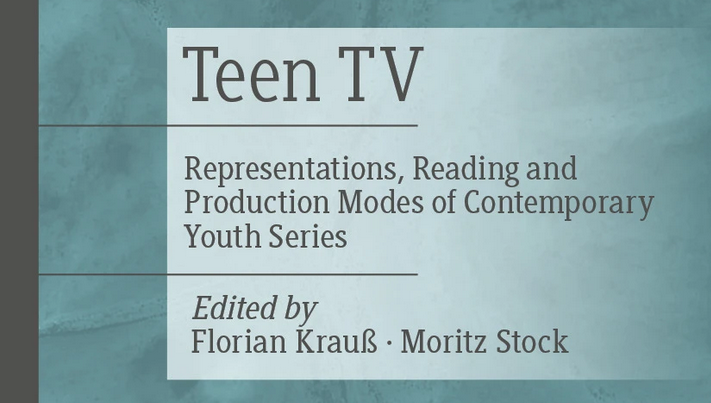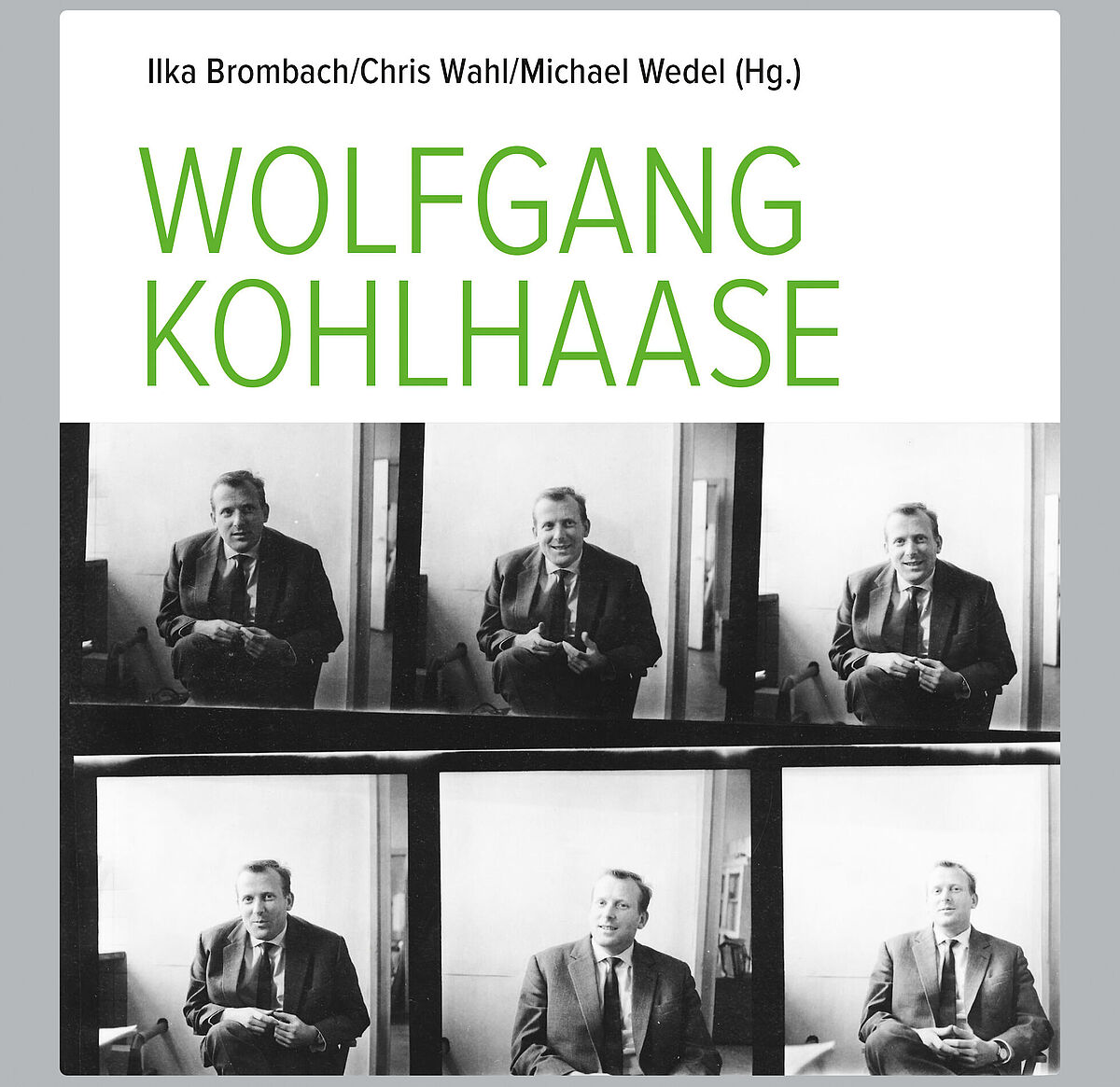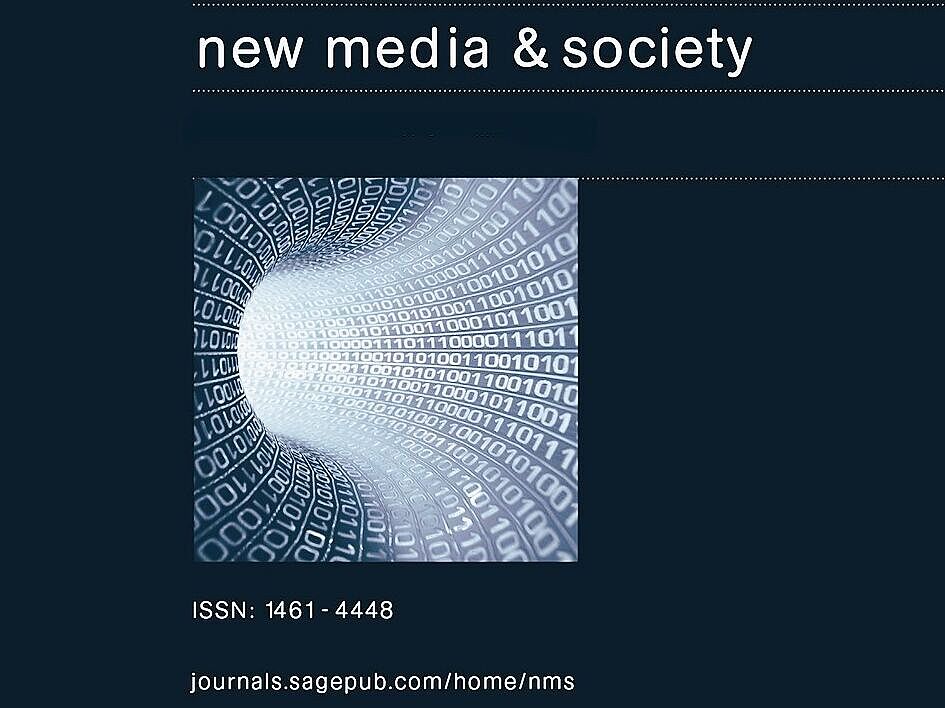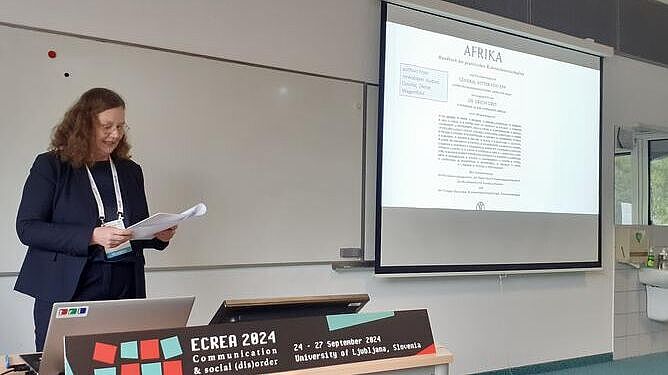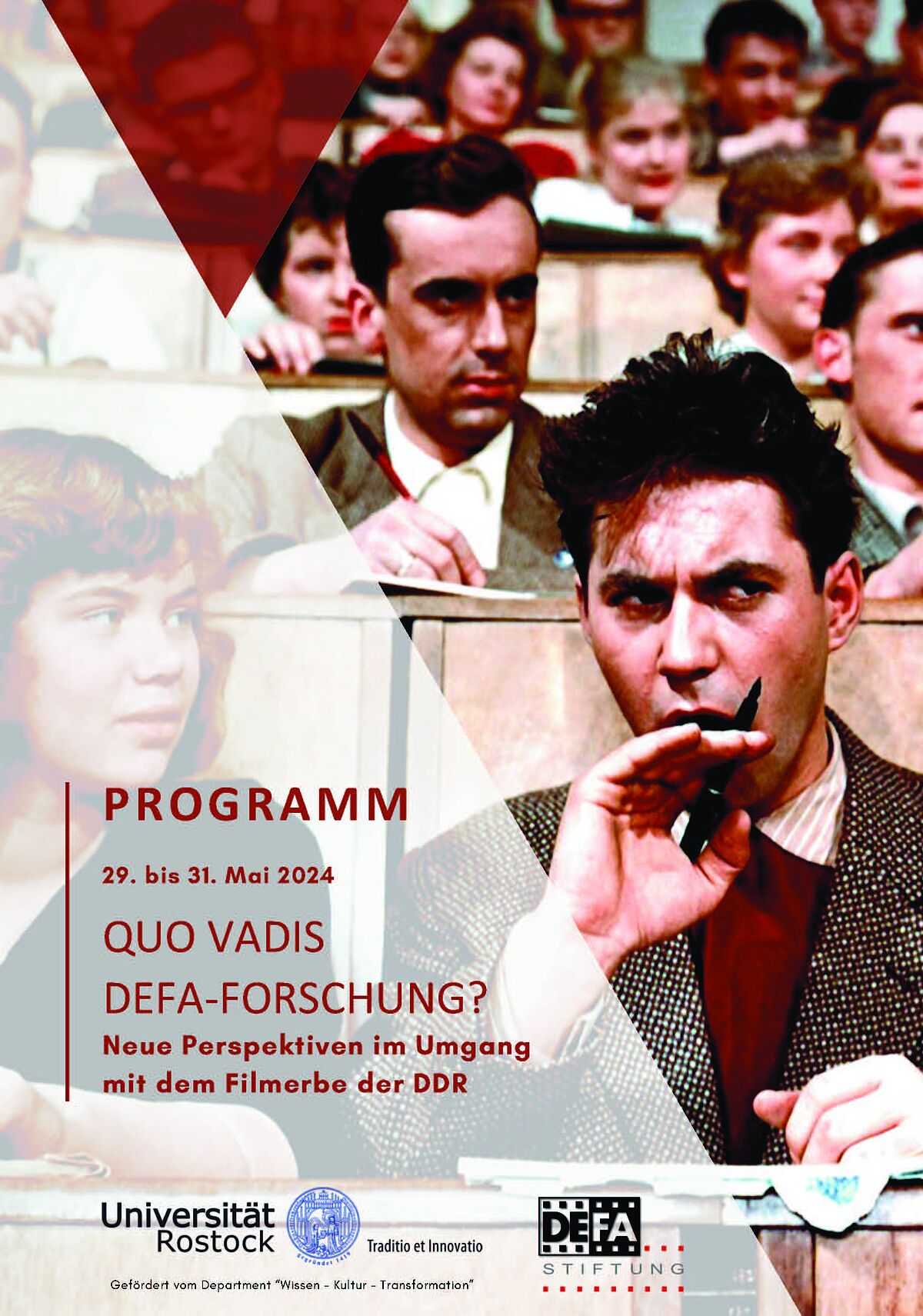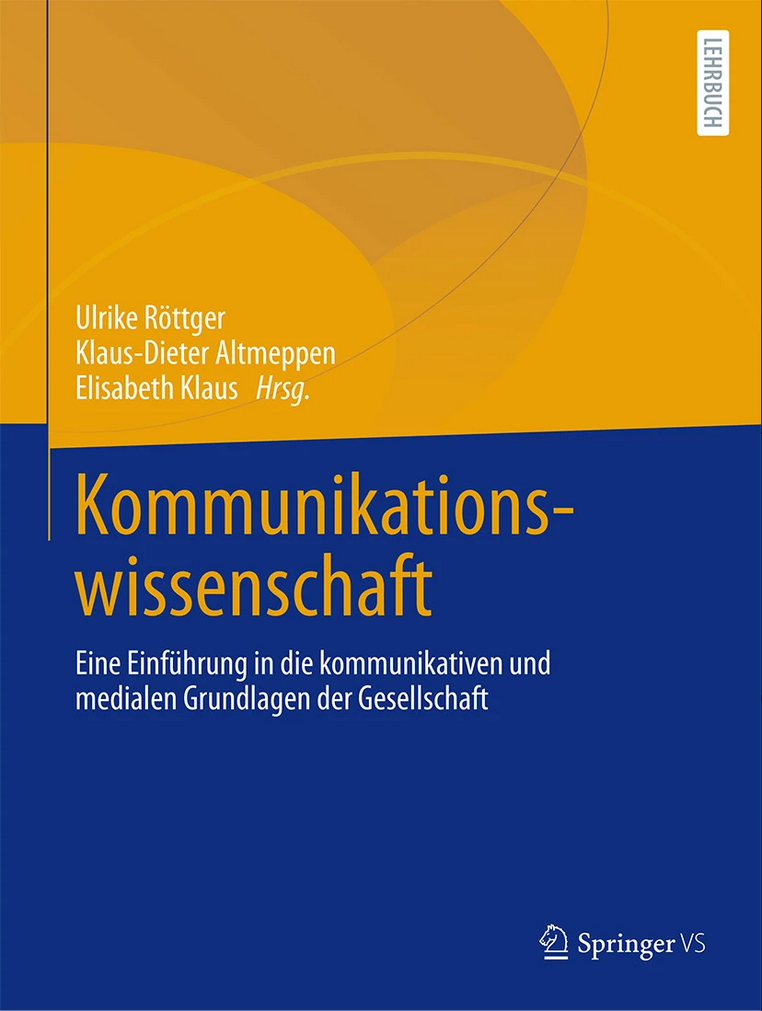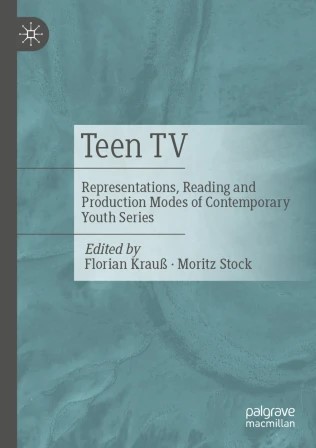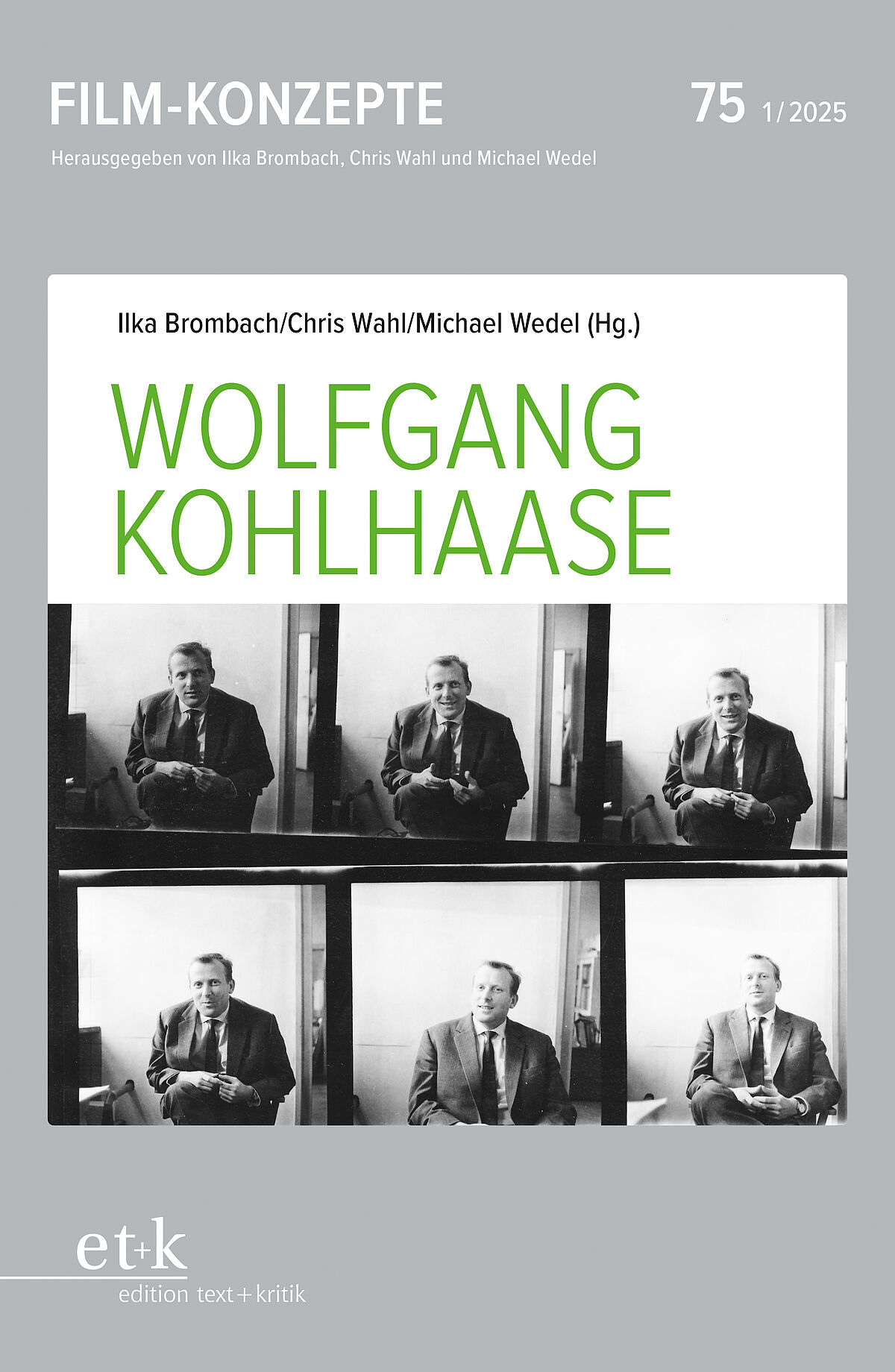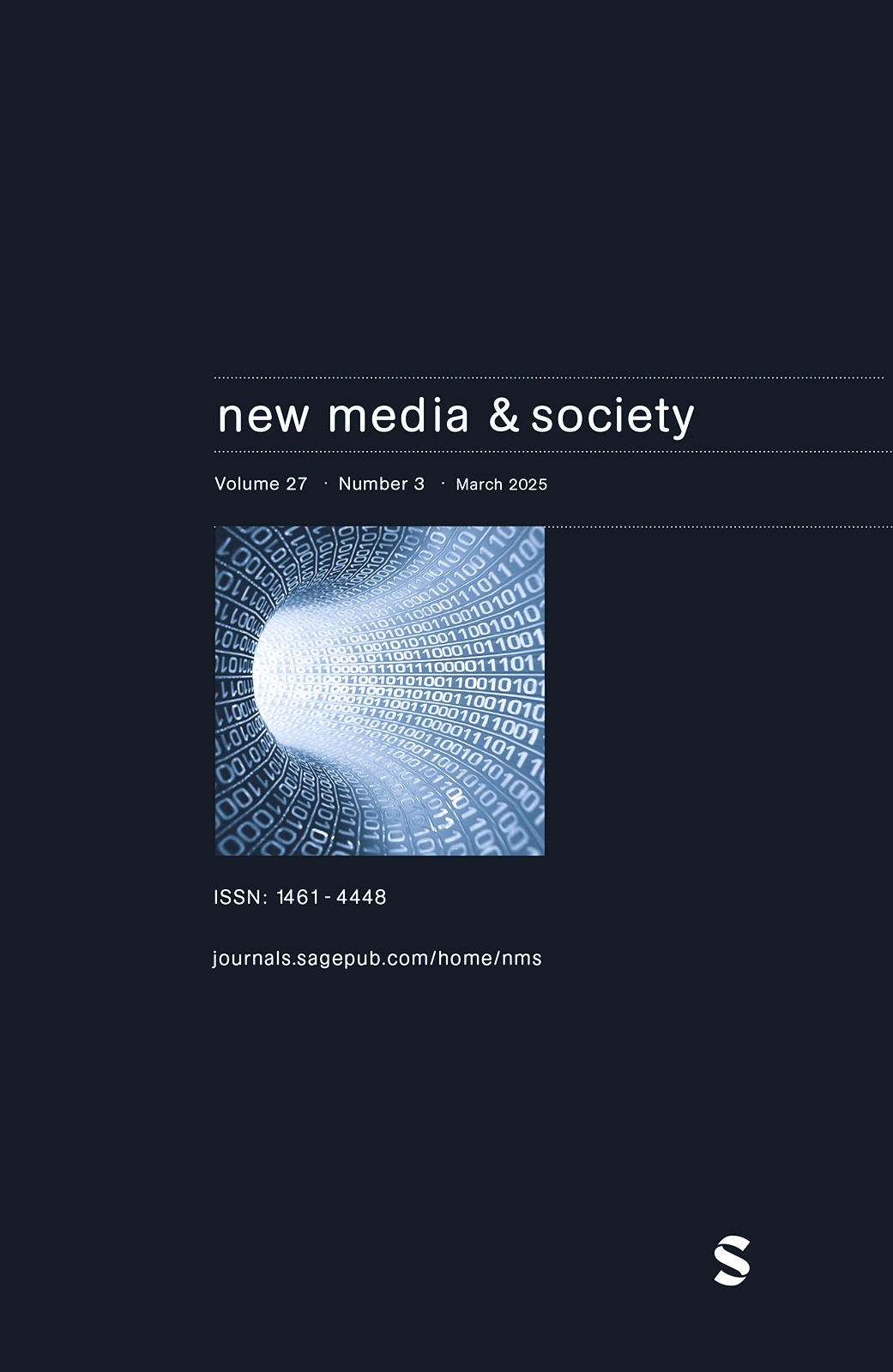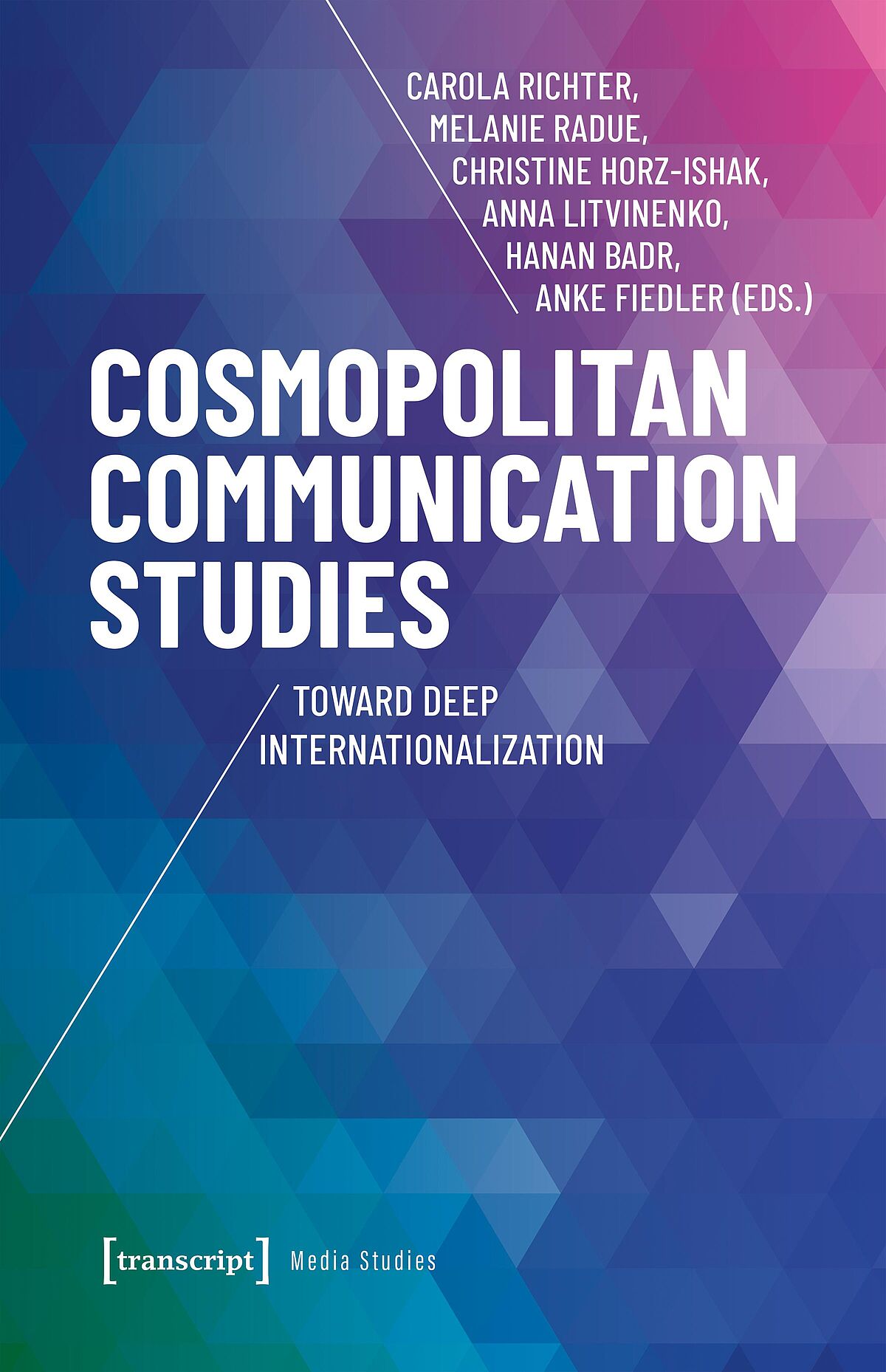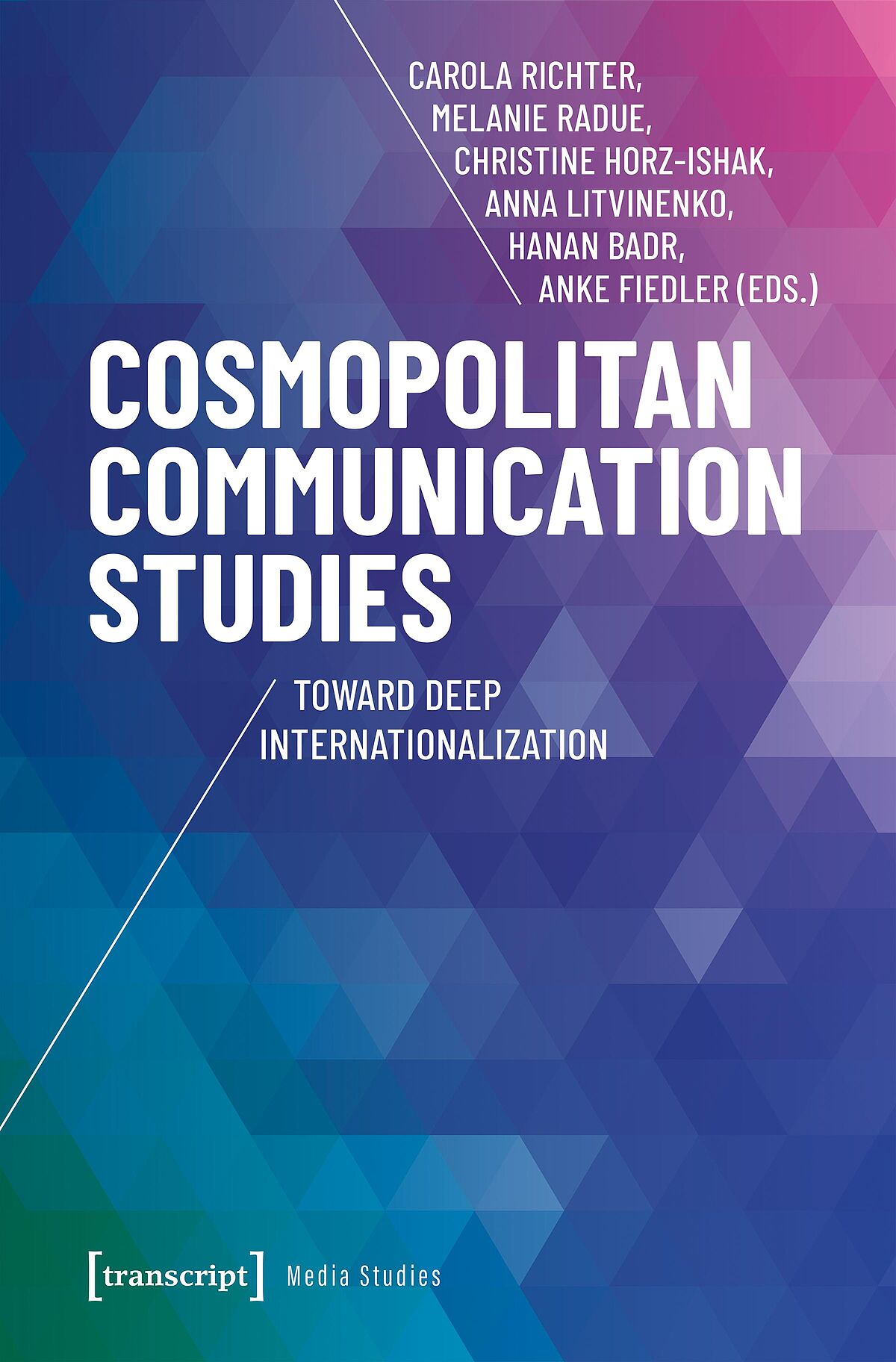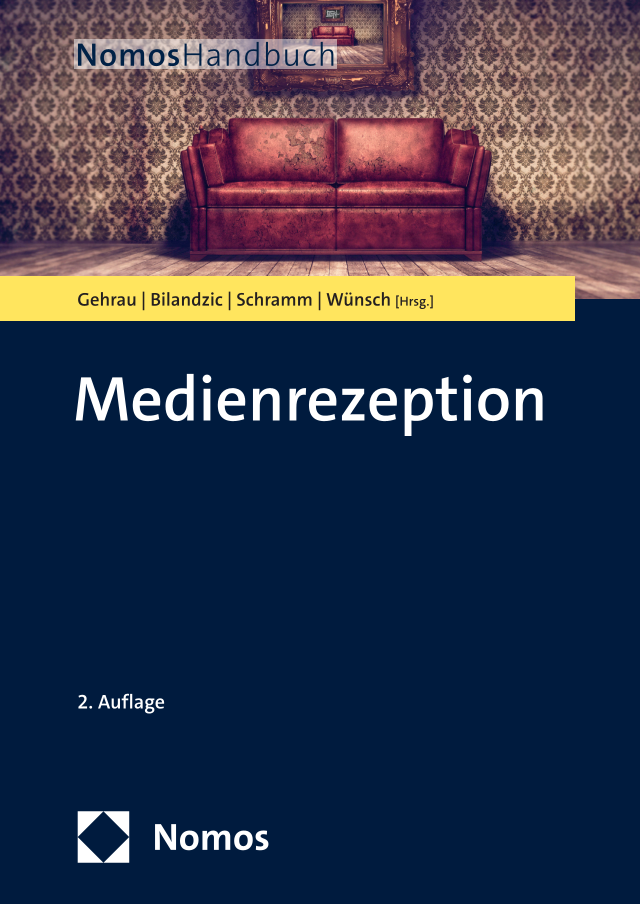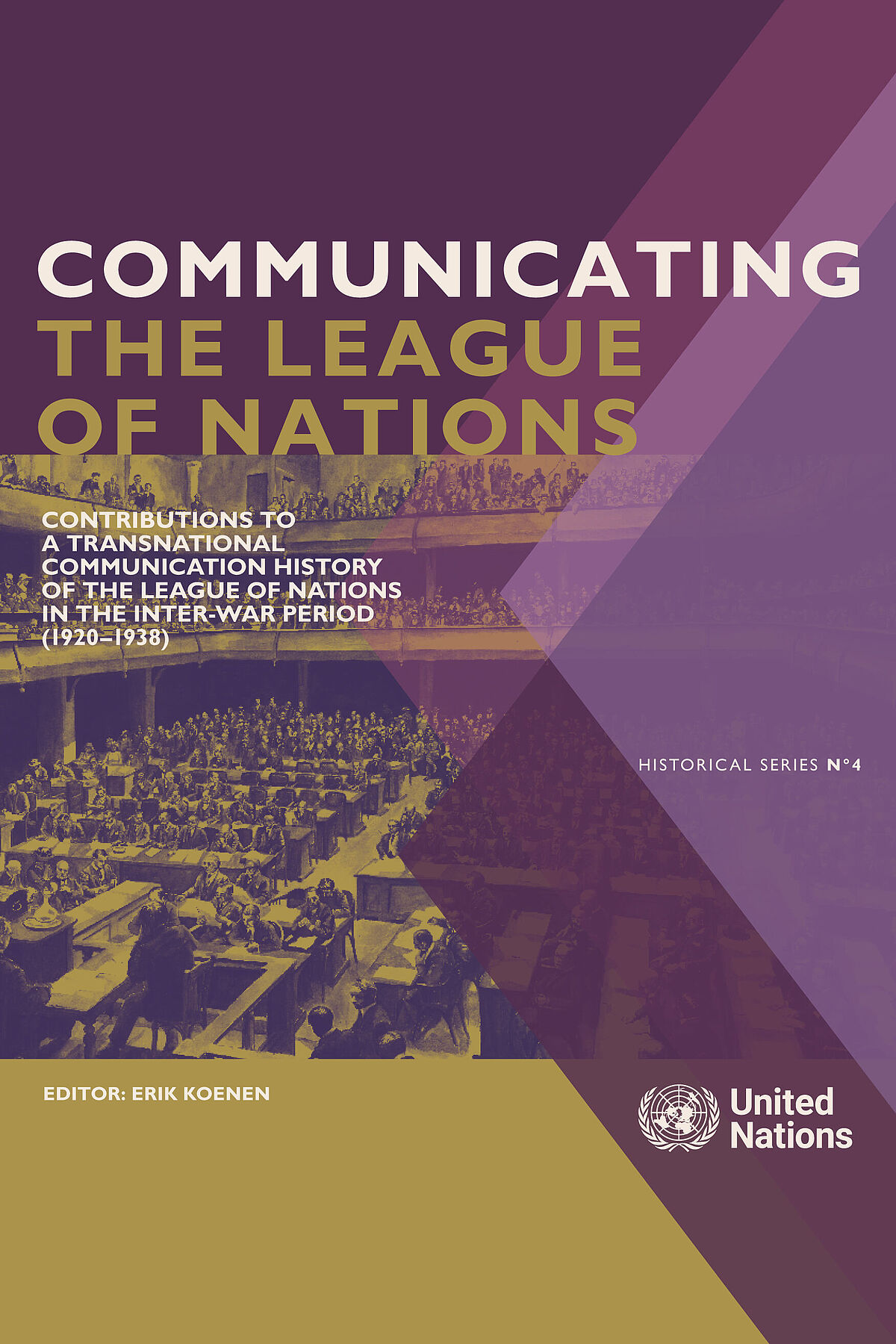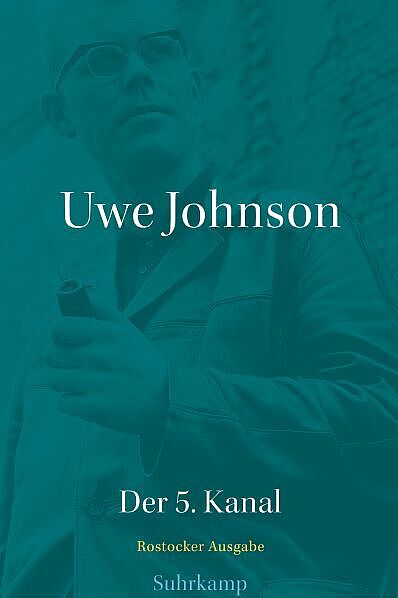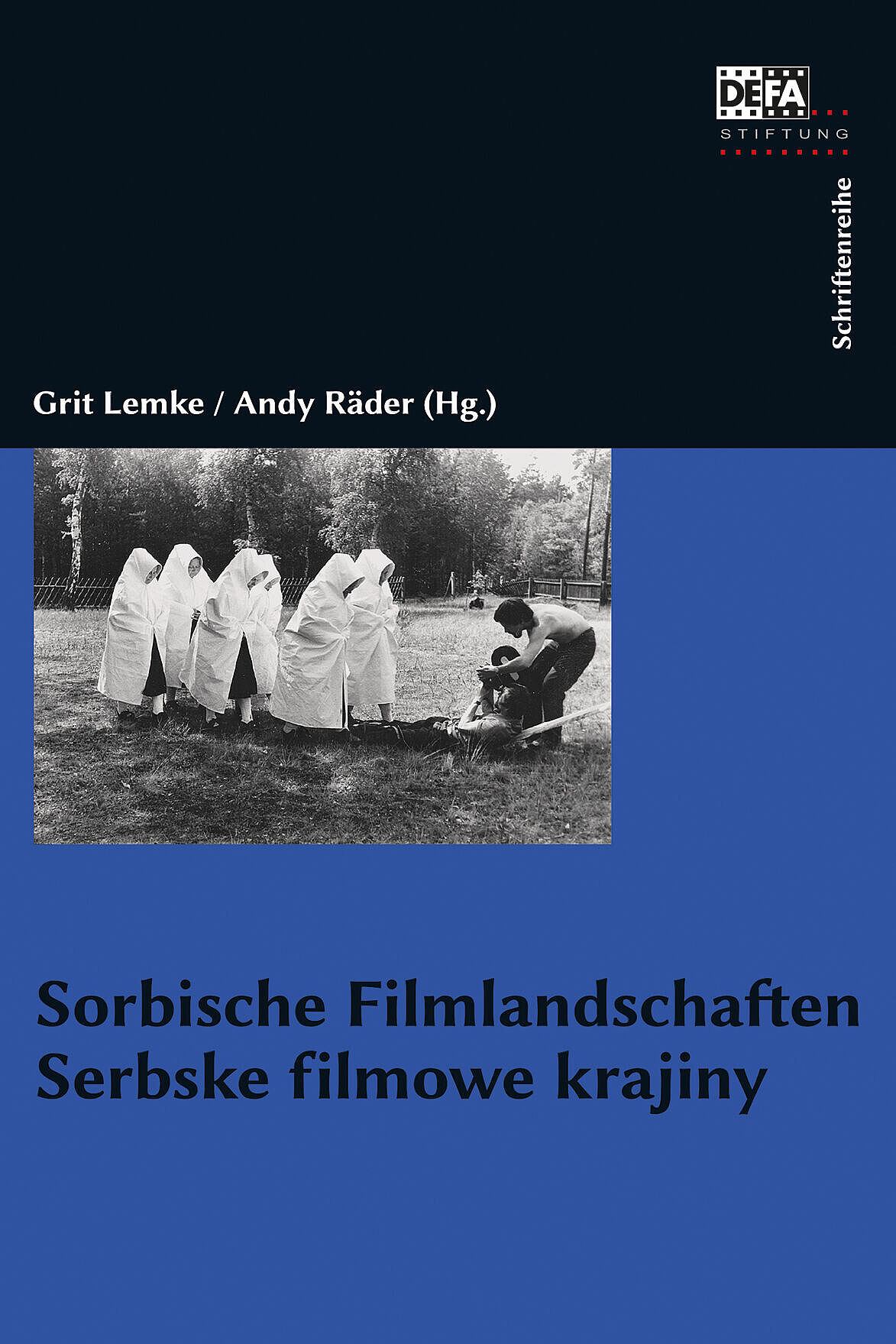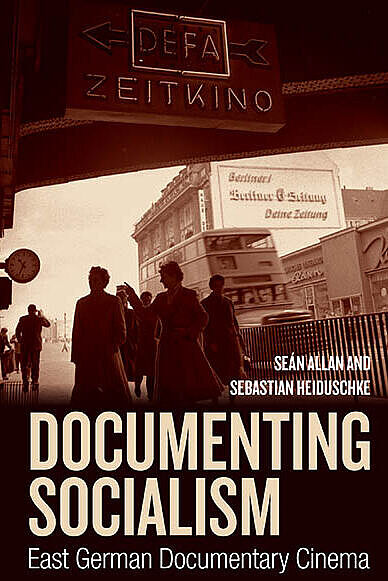Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Kommunikationsethik
Die Lehre und Forschung am Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Kommunikationsethik erfolgt in enger Kooperation mit den anderen Lehrstühlen am Institut (Kommunikationswissenschaft und Organisationskommunikation).
Kommunikationsethische Fragen leiten sich aus der Allgemeinen Kommunikationswissenschaft und ihrer Theoriebildung ab und sind relevant z.B. in der Mediensystemforschung und in der (Medien-)Organisationsforschung.
Inhaltlich richtet sich die Lehre und die Forschung auf Kommunikationsethik unter Bedingungen des Medienwandels. Dies schließt eine kommunikationshistorische Sicht auf den längerfristigen Wandel von Öffentlichkeit und Mediensystemen ein, ebenso wie den Blick auf die Inhalte der Medienkommunikation und deren Qualität, auf Professions- und Vermittlungsrollen (in Journalismus, PR, Werbung, Publizistik, Blogging, Influencing etc.) sowie Regeln (Normen und zugrunde liegende Werte) und die Regulierung der öffentlichen Kommunikation (Selbst- und Ko-Regulierung der Medien).
Die historisch-systematische Perspektive hilft zu verstehen, warum wir welche Wertbezüge in öffentlicher Kommunikation zugrunde legen können und sollten. Diese haben sich ebenso wie die Kommunikationsfreiheit unter bestimmten sozialen, ökonomischen und politischen Gegebenheiten entwickelt und bestimmen die „Reflexions- und Steuerungsfunktion“ (B. Debatin), die Kommunikations- und Medienethik in der Gesellschaft erbringt, mit.
Inter-/transnationale Perspektiven ergänzen diese Orientierung. Länderschwerpunkte am Lehrstuhl sind Deutschland, Frankreich und Großbritannien sowie teilweise Bezüge zu lateinamerikanischer Forschung. Dabei ist die Herangehensweise oft komparativ.
Die theoriegeleitete Beschäftigung mit Kommunikationsethik wird in der Lehre mit kommunikationspraktischer Relevanz verbunden. Dies betrifft nicht nur das eigene kommunikative und mediale Handeln der Studierenden, folglich deren Kommunikations- und Medienkompetenz, sondern auch den Erwerb von Handlungskompetenzen für das spätere Berufsleben in Journalismus, PR und anderen Feldern wie Organisationskommunikation, Medienregulierung oder Medienbildung sowie der angewandten Medien- und Kommunikationsforschung.
Übergreifend spielen Theorien der Medienkommunikation in der Lehre und Forschung ebenso eine Rolle wie solche der interpersonalen Kommunikation. Interpersonale Kommunikation ist zentral für die Vermittlung von Einstellungen, Meinungen und Werten auch in einer mediatisierten Gesellschaft. Interpersonale Kommunikation findet in der privaten ebenso wie der öffentlichen Kommunikation nicht mehr nur vorrangig in gemeinsamer örtlicher und/oder zeitlicher Präsenz statt, sondern vermehrt mittels sozialer Medien und digitaler Kommunikationstools, die Zeit-Raum-Relationen entgrenzen.
Fragen der digitalen Kommunikations- und Medienethik, auch der KI-Ethik, stellen die Lehre und die Forschung vor neue Herausforderungen und werden in der Lehre und der Forschung adressiert.
Das Forschungsprofil des Lehrstuhls zeichnet sich dadurch aus, dass es kommunikationsethische, -theoretische und -historische Schwerpunkte auf der Basis vorrangig qualitativer Kommunikationsforschung zusammenführt (einzelne Forschungsprojekte schließen standardisierte, z.B. inhaltsanalytische oder befragungsbasierte Verfahren ein). Auch werden Fragestellungen der inter- und transkulturellen Kommunikationsforschung mit kommunikationsethischen Fragen verbunden.
Die Forschungsprojekte sowie Dissertations- und Habilitationsprojekte bringen verschiedene Felder der Kommunikations-wissenschaft zusammen. Verbunden werden sie durch normative, kompetenzorientierte Perspektiven und die Frage nach den Gütekriterien von öffentlich relevanter Kommunikation.
Forschungsprojekte
Pinnwand
Prof. Dr. Averbeck-Lietz hat am 15. Mai 2025 in der Abt. Journalistik der Bundeswehruniversität München auf Einladung von Prof. Dr. Irene Preisinger, Professur für Redaktionspraxis, einen Seminarvortrag zu "Desinformation als Kommunikatonsform" gehalten.
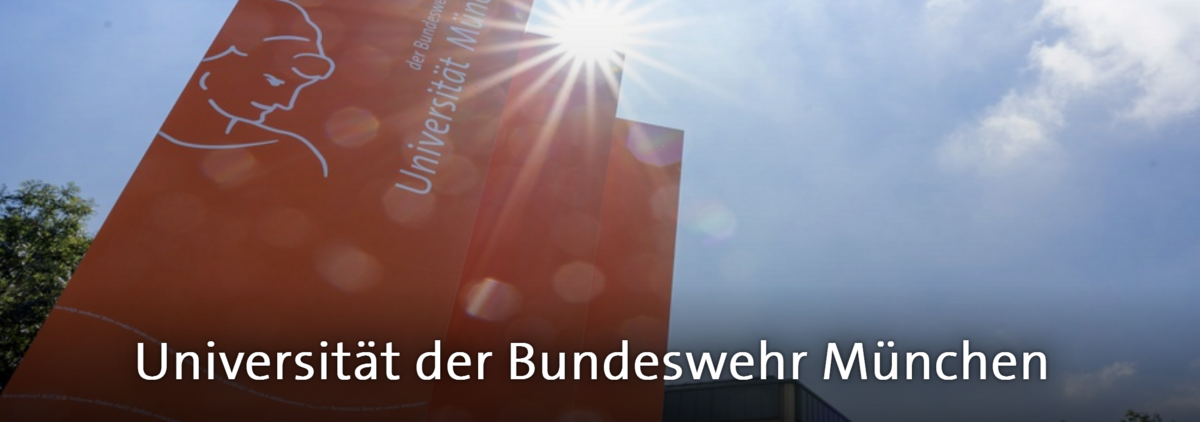
Stefanie Averbeck-Lietz hält am 8. Mai 2025 auf der Tagung "Was ist Kommunikationsgeschichte?", die das Institut für Zeitungsforschung in Dortmund ausrichtet,
einen Vortrag zur kommunikatiionshistorischen Lehre und deren Relevanz auch und gerade in Zeiten von KI
Stefanie Averbeck-Lietz, Lisa Bolz und Otávio Daros haben gemeinsam einen Aufsatz zur (mangelnden) Inter-/Transnationalisierung des Faches Kommunikationswissenschaft unter französischer, brasilianischer und deutscher Perspektive verfasst.
Der Artikel "Historical trajectories of entanglement and ignorance - German, French, and Brazilian communication studies in dialogue" ist in diesem Sammelband zur Kosmopolitischen Kommunikationswissenschaft erschienen:
Stefanie Averbeck-Lietz hat ein Lehrbuchkapitel zu Theorien der Kommunikation und Theoriebildung in der Kommunikationswissenschaft publiziert
Der 5. Kanal. Uwe Johnson und das Fernsehen der DDR
Filmreihe - kuratiert von Andy Räder
gemeinsam mit Yvonne Dudzik und Denise Naue
vom 25. April bis 18. Mai 2025
im Zeughauskino des Deutschen Historischen Museums, Berlin
Zwischen Juni und Dezember 1964 rezensierte der Schriftsteller Uwe Johnson für den Tagesspiegel das DDR-Fernsehen. Unter dem Titel "Der 5. Kanal" wurden diese Kritiken 1987 posthum veröffentlicht. Im Rahmen der Uwe-Johnson-Werkausgabe sind sie 2024 in einer kommentierten Neuedition erschienen – herausgegeben vom Medienwissenschaftler Andy Räder sowie den Literaturwissenschaftlerinnen Yvonne Dudzik und Denise Naue. Die Filmreihe im Zeughauskino des Deutschen Historischen Museums in Berlin präsentiert ausgewählte Filme und Fernsehsendungen des DDR-Fernsehens, die Johnson in seinen Kritiken besprochen hat. Im Anschluss an die Vorführungen diskutieren die Herausgeber*innen mit nationalen und internationalen Forschenden sowie Zeitzeug*innen über die oft wenig bekannten Produktionen und über Uwe Johnsons präzisen, oft kritischen Blick auf das DDR-Fernsehen.




Dr. Andy Räder hat in der medienwissenschaftlichen Publikation über den aktuellen Boom des Jugendfernsehens einen Aufsatz über die Darstellung von Krebserkrankungen in der Netflix-Serie "Alexa & Katie" verfasst
Öffentlichkeit(en) und ihre Werte
70. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft - 19. bis 21. März 2025 in Berlin
Der Lehrstuhl Kommunikationsethik hielt folgende Vorträge und war an einer Podiumsdiskussion beteiligt:
» Vorträge
Stefanie Averbeck-Lietz
Pluralität als Wert demokratischer Öffentlichkeit. Kommunikationsethische Begründung mit Bezug auf das Konzept der Geltungsansprüche nach Habermas
Jasmin Buddensiek; Sabine Bosler (Université de Haute-Alsace)
Medienpädagogische Lehrer:innenbildung im deutsch-französischen Vergleich: Werte, Motivation, Einstellungen
» Podiumsdiskussion
Wider die nationale Schließung: Die Potentiale von Diversität und Internationalisierung für die deutschsprachige Kommunikationswissenschaft
Input und Diskussionsteilnahme Stefanie Averbeck-Lietz (gemeinsam mit Hanan Badr, Univ. Salzburg; Anne Grüne, Univ. Erfurt; Ana-Nzinga Weiß, Univ. Rostock)
» Panelmoderation
Dr. Anke Fiedler moderierte das Panel Kontinuität und Wandel von Kommunikation und Öffentlichkeit
Dr. Andy Räder hat in der Schriftenreihe Film-Konzepte zu Wolfgang Kohlhaases Relevanz als Autor für ein junges Publikum einen Aufsatz verfasst
Dr. Anke Fiedler hat in der renommierten Fachzeitschrift 'New Media & Society' zur Öffentlichkeit im "Digitalen Dorf" publiziert
Geltungsansprüche „pluralistisch-transzendentaler Öffentlichkeit“ als normative Grenzziehungen gegen populistische Kommunikation „qualitativer Öffentlichkeiten“: Zur Integration der Ansätze von Habermas und Manheim
Vortrag von Stefanie Averbeck-Lietz
an der Akademie für politische Bildung in Tutzing am 21. Februar 2025
Stefanie Averbeck-Lietz hat anlässlich der Tagung des Netzwerks Medienethik und der DGPuK-Fachgruppe Kommunikations- und Medienethik zum Tagungsthema „Zwischen Hassrede, Framing und generativer Künstlicher Intelligenz ̶ Medien und Sprache aus ethischer Perspektive“ einen Vortrag zu demokratischer Öffentlichkeit und ihrer Gefährdungen gehalten.
Stefanie Averbeck-Lietz und Simon Sax fragen in ihrem Artikel danach, wie Menschen in frühreren Zeiten Medien rezipiert haben. Welche Praktiken des An-Sehens, Vor-Lesens, und Zu-Hörens haben sie entwickelt?
The unrevealed colonial perspectives of German Newspaper Studies during the 1930/40s. Or: The lack of epistemic memory in the field of communication studies
Vortrag von Stefanie Averbeck-Lietz
auf der 10. Tagung der European Communication and Research Association (ECREA)
"Communication & social (dis)order" am 27. September 2024 in Ljubljana, Slowenien
im Panel des Netzwerks Kosmopolitische Kommunikationswissenschaft (Koordination Prof. Dr. Carola Richter, FU Berlin)
Serbska filmowa skupina: Die DEFA-Produktionsgruppe 'Sorbischer Film'
Vortrag von Andy Räder
auf dem Filmerbe-Festival / The Film Heritage Festival "Film Restored"
am 24. Oktober 2024 an der Deutschen Kinemathek, Berlin
Echoes of East Germany's Cultural Heritage: Fred Kelemen’s Transnational Cinema
Vortrag von Andy Räder
auf der 48. Annual Conference der GSA - German Studies Association am 27. September 2024 in Atlanta, Georgia (USA)
im Panel "Covergence of Avantgarde and Heritage in East German Cinema" (Koordination Prof. Dr. Mariana Ivanova, University of Massachusetts und Prof. Dr. Anna Harakova, University of Connecticut)
Quo vadis DEFA-Forschung? Neue Perspektiven im Umgang mit dem Filmerbe der DDR
Internationale Fachtagung - organisiert von Andy Räder
gemeinsam mit Elizabeth Ward (Universität Leipzig)
vom 29. bis 31. Mai 2024 an der Universität Rostock
Beitrag im NDR Nordmagazin vom 1. Juni 2024:
Kino der DDR: Internationale Tagung an der Uni Rostock
► Mediathek (verfügbar bis 01.06.2026)
Tagungsbericht: H-Soz-Kult vom 6. November 2024
Sorbische Filmlandschaften
Filmreihe - kuratiert von Andy Räder
und Grit Lemke
vom 26. April bis 14. Mai 2024
im Zeughauskino des Deutschen Historischen Museums, Berlin
In der südlich von Berlin gelegenen Lausitz lebt eine von vier in der Bundesrepublik anerkannten autochthonen, also altansässigen nationalen Minderheiten: die Sorben, die auch Wenden genannt werden. Sie bilden das kleinste slawische Volk und pflegen eine eigene Sprache und Kultur. Trotz einer jahrhundertelangen Germanisierung stellte das sorbische Volk bis weit ins 20. Jahrhundert in der Lausitz die Bevölkerungsmehrheit dar, doch durch die Industrialisierung, die Zerstörung seiner Dörfer durch den Braunkohletagebau und vor allem den Assimilierungsdruck hat sich die Zahl der Sorbisch sprechenden Menschen dramatisch verringert, sorbische Kultur und Identität sind bedroht.
Um die Sichtbarkeit sorbischer Filmkultur und das Interesse an sorbischer Filmgeschichte ist es kaum besser bestellt. Wenngleich schon Anfang der 20. Jahrhunderts Sorbinnen und Sorben vor und hinter der Kamera standen, hat sich die Filmgeschichtsschreibung wenig für den sorbischen Film interessiert. Auf dieses Manko reagiert die jüngst in der Schriftenreihe der DEFA-Stiftung erschienene Monografie Sorbische Filmlandschaften / Serbske filmowe krajiny der Film- und Kulturwissenschaftler Grit Lemke und Andy Räder. Die von ihnen kuratierte Filmreihe gibt erstmals einen umfassenden Überblick über das sorbische Filmschaffen vom Kaiserreich bis in die Gegenwart. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Produktionen der DEFA und der Babelsberger Filmhochschule aus den Jahren 1946 bis 1992. Zahlreiche Filme entstanden in dieser Zeit, vor allem in der DEFA-Produktionsgruppe „Sorbischer Film“ („Serbska filmowa skupina“) in Bautzen/Budyšyn. Von 1980 bis zur Auflösung der DEFA wurden fast 40 Filme in ober- und niedersorbischer Sprache produziert, von denen meist auch deutsche Fassungen hergestellt wurden – eine historisch und international beispiellose Förderung der Filmkunst einer ethnischen Minderheit bzw. eines indigenen Volkes.
Die Filmauswahl der Reihe bewegt sich vom opulenten Spielfilm über den klassischen Kulturfilm, propagandistisch gefärbte oder ethnografische Dokumentationen zum künstlerischen Dokumentarfilm und experimentellen Formen einer neuen, selbstbewussten Generation sorbischer Filmschaffender. Sie kreist auch um Fragen der Blickperspektiven. Inwiefern folgt die Darstellung sorbischen Lebens einem von außen kommenden, möglicherweise kolonial geprägten Blickwinkel? Wie wichtig sind Innenperspektiven? Spielen Stereotype eine Rolle? Wird Sorbisch gesprochen? Themen sind neben der sorbischen Filmproduktion bei der DEFA auch die Unterdrückung der Sorben in der Zeit des Nationalsozialismus und der vor allem weibliche Widerstand dagegen, Bräuche und Traditionen, die nationale Identität und der Zusammenhang von ökologischer Katastrophe und ethnischer Zerstörung. Sofern verfügbar werden die sorbischen Fassungen der Filme gezeigt.




Aktuelle Publikationen > 2025 <
Book Chapter
Stefanie Averbeck-Lietz:
Theorien (in) der Kommunikationswissenschaft.
In: Ulrike Röttger, Klaus Dieter Altmeppen und Elisabeth Klaus (Hrsg.): Kommunikationswissenschaft. Eine Einführung in die kommunikativen und medialen Grundlagen der Gesellschaft.
Wiesbaden: Springer VS 2025, S. 179-223;
ISBN 978-3-658-44283-5.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-44163-0_5
Die Kommunikationswissenschaft verfügt über eine Vielfalt von Theorien (Theorienpluralismus). Dieses Kapitel führt in die Grundlagen der kommunikationswissenschaftlichen Theoriebildung ein und zeigt, dass es a) keine universale, allgemein gültige Kommunikationstheorie gibt und dass b) Kommunikationstheorien eng verbunden sind mit ihrem Gegenstand, der (technisch) medial vermittelten Kommunikation und ihres Wandels (Medien- und Kommunikationswandel). Kommunikations-theorien greifen c) auf übergeordnete, oft soziologische Basistheorien zurück. Diese wiederum beziehen sich auf Kommunikation als Gegenstand spezifischer Überlegungen. Es wird weiterhin aus einer wissenschaftstheoretischen und wissenschafts-soziologischen Perspektive darauf eingegan-gen, was wissenschaftliche Theorien sind, wie sie entstehen, welche grundlegenden Basistheorien des Sozialen das Fach Kommunikationswissen-schaft prägen und auf welche Forschungsgegenstände sie sich richten. Dabei wird der Blick vor allem auf Interaktionstheorien respektive Handlungs-theorie und Symbolischer Interaktionismus, Sozialkonstruktivismus, Kritische Theorie und Systemtheorie gelegt. Als Basistheorien prägen sie die kommunikationswissenschaftliche Theoriebildung maßgeblich.
Book Chapter
Andy Räder und Julia Stüwe:
Disease in Series: The Portrayal of Cancer in the Netflix Production Alexa & Katie.
In: Florian Krauß und Moritz Stock (Hrsg.): Teen TV. Representations, Reading and Production Modes of Contemporary Youth Series.
Wiesbaden: Palgrave Macmillan 2025, S. 107-127;
ISBN 978-3-658-44162-3.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-44163-0_5
Cancer in adolescence seems to be virtually predestined for serial storytelling due to the real chances of cure in this age group and the protracted, usually dramatic and emotional course of the disease. So far, however, fictional film and television productions have hardly dealt with cancer in adolescents. One of the few exceptions is the Netflix production Alexa & Katie (Alexa and Katie, USA 2018–). Following recent oncological studies on adolescents and young adults with cancer, this paper presents a media-specific model of analysis that can be used as a starting point for an investigation of cancer-related themes and motifs with their narrative, dramaturgical, figurative, and genre-specific features. The results of the sample analysis show that the handling of the life-threatening disease in the youth series Alexa & Katie is done in an exceedingly realistic way. At the same time, the life-threatening illness is rarely the focus. Rather, the series focuses on the protagonist’s attempt to put the disease behind her. By focusing on the developmental stages of adolescence, the Netflix production succeeds in portraying the topic of cancer in children and adolescents in a realistic way.
Book Chapter
Andy Räder:
Schreiben für Kinder und Jugendliche: Wolfgang Kohlhaases erste Filmarbeit Die Störenfriede (1953).
In: Ilka Brombach, Chris Wahl und Michael Wedel (Hrsg.): Wolfgang Kohlhaase.
München: edition text+kritik 2025 (Film-Konzepte 75; 1/2025), S. 13-24;
ISBN 978-3-689-30020-3.
Wolfgang Kohlhaase (1931-2022), dessen Schaffen über 30 Filme umfasst und sich weit über ein halbes Jahrhundert erstreckt, gehört zu den bedeutendsten Drehbuchautoren der (deutsch-)deut-schen Filmgeschichte. Seine Zusammenarbeit mit den Regisseuren Gerhard Klein und Konrad Wolf bei Filmen wie Berlin – Ecke Schönhauser (1957), Ich war neunzehn (1968) oder Solo Sunny (1980) hat Meilen-, zugleich immer auch Stolpersteine in die Geschichte der DEFA gesetzt. Seine Drehbücher für Andreas Dresen (u.a. Sommer vorm Balkon, 2005, Als wir träumten, 2015), aber auch Volker Schlöndorff (Die Stille nach dem Schuss, 2000) oder Matti Geschonneck (In Zeiten des abnehmenden Lichts, 2017) haben verlässlich für künstlerische Höhepunkte des Nachwendekinos gesorgt. Die Beiträge zu diesem Band schlagen thematische und motivische Schneisen durch das umfangreiche Gesamtwerk Kohlhaases. Sie widmen sich der Darstellung von Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg in seinen Filmen, gehen dem wiederkehrenden Thema eines geteilten Deutschlands nach, diskutieren seinen Umgang mit Frauenfiguren und jugendlichen Helden und betrachten das Wechselspiel von Humor und Lebensnähe. Ein persönliches Porträt Kohlhaases und unveröffentlichte Texte aus dem Nachlass runden den Band ab.
Journal Chapter
Anke Fiedler:
The “digital village” revisited, or the re-ruralization of the public and private spheres in contemporary digitality.
In: New Media & Society 2025, Vol. 27, Issue 1, pages 168-184.
https://doi.org/10.1177/14614448231172976
This article aims to make a theoretical contribution to clarify the societal impact of the reorgani-zation of public and private in the digital age. Drawing on the spatial-sociological approach of German sociologist HP Bahrdt, the discussion is guided by the thesis that the specific dynamics of privacy risk attributed to the digital revolution pre-date the digitized age, specifically in rural environments. The analogy between rurality and digitality is used to illustrate why the increasing blurring of public and private through transparency potentials — along with the accompanying convergence of social contacts (characteristic of both rural and digital space) — threatens not only individual privacy but also democratization by violating forms of individual freedom that are constitutive of a critical public realm. Therefore, this article serves as a call to understand digital privacy protection as one of the pressing challenges of our time.
Book Chapter
Stefanie Averbeck-Lietz/Lisa Bolz/Otávio Daros:
In: Carola Richter, Melanie Radue, Christine Horz-Ishak, Anna Litvinenko, Hanan Badr und Anke Fiedler (Hrsg.): Cosmopolitan Communication Studies. Toward Deep Internationalization.
Bielefeld: transkript 2025, S. 27-51;
ISBN print: 978-3-8376-7677-8.
Introduction
International research is one of the major buzzwords in career strategies and research projects, but this does not mean that communication studies have therefore become more “cosmopolitan” in a normative sense of openness for different or even unknown traditions. Various factors such as (mutual) ignorance and isolation can—in part—explain dynamics that we observe today: when speaking about “international research,” often only a certain type of international research is taken into consideration (i.e., comparative project-based research relying on third-party funding). International career paths work well within the Western European and US-American spheres, but hardly beyond. We therefore suggest taking a close look at some of the results of international ignorance and isolation as well as at the lack of transnational academic crossings. This article is a first attempt to write the history of the field of communication studies from a cosmopolitan perspective, while the communities under analysis have been and remain more or less disconnected from each other. Our aim—not least based on personal experiences as researchers in all three contexts of German, French and Brazilian research—is to show that a concept such as “cosmopolitanism” challenges not only the epistemological and methodological perspectives of communication studies but also its social shape. Who did research with whom about what (e.g., in journalism research or media system research), and was this from a more national perspective or a more inter- or transnational one? What role do language barriers play (Simonson et al., 2022), what role national historical, political, and economic contexts of communication studies (Löblich & Scheu, 2011), not least the policies and politics regarding the universities as organizational and institutional bodies for a cosmopolitan turn?
Editorship
Carola Richter, Melanie Radue, Christine Horz-Ishak, Anna Litvinenko, Hanan Badr und Anke Fiedler (Hrsg.):
Cosmopolitan Communication Studies: Toward Deep Internationalization
Bielefeld: transcript 2025 (Media Studies);
ISBN print: 978-3-8376-7677-8.
This volume proposes a “deep internationalization” of media and communication studies by of-fering insights and guidance on how to integrate a cosmopolitan perspective in a variety of sub-fields of this discipline. Building on debates on de-Westernization and cosmopolitanism, the contributors advocate for the inclusion of both global and local perspectives and context-led approaches. They argue that acknowledging and incorporating epistemologies, topics, and methodologies from diverse regions, contexts, and backgrounds will enhance the comprehen-siveness and relevance of their discipline and foster a more inclusive and meaningful under-standing in communication studies.
Book Chapter
Stefanie Averbeck-Lietz und Simon Sax:
Medierezeption im historischen Kontext.
In: Volker Gehrau, Helena Bilandzic, Holger Schramm und Carsten Wünsch (Hrsg.): Handbuch Medienrezeption, 2. Auflage.
Baden-Baden: Nomos 2025 (NomosHandbuch), S. 613-637;
ISBN print: 978-3-8487-7384-8.
Das Handbuch bietet einen umfassenden Überblick über die Gegenstände und Theorien der Rezeptionsforschung. In den 37 Beiträgen wird ein systematischer Zugang zum State of the Art der jeweiligen Thematik aus einer kommunikationswissenschaftlichen Perspektive gelegt. Die umfassend aktualisierte und erweiterte 2. Auflage befasst sich in vier Teilen: (1) mit grundlegenden Konzepten der Medienrezeption, (2) mit Fragen der Zuwendung und Selektion, (3) mit spezifischen Phänomenen und Erlebnisweisen und (4) mit den wichtigsten Kontexten der Medienrezeption. Moderne Medienwirkungstheorien kommen ohne die Betrachtung von Rezeptionsprozessen nicht mehr aus. Im Handbuch werden daher die Prozesse vor und während der Mediennutzung im Detail betrachtet. Zielgruppe des Handbuchs ist das breite Fachpublikum der Kommunikationswissenschaft und angrenzender Fächer wie Soziologie, Psychologie, Politikwissenschaft und Erziehungswissenschaft.
Book Chapter
Stefanie Averbeck-Lietz:
In: Koenen, E. [United Nations] (ed.): Communicating the League of Nations. Contributions to a Transnational Communication History of the League of Nations in the Inter-War Period (1920–1938).
Geneva: United Nations 2024 (United Nations Historical Series), pp. 59-132;
ISBN (PDF): 9789213589274
https://doi.org/10.18356/9789213589274c003
The volume aims to contribute to a deeper understanding of the League of Nations (1920-1946) as an international organization with complex transnational communication relations from a perspective of communication researchers. The authors focused on the reconstruction of internal communication processes within the Information Section as well as its strategies of external public communication The complex relationships between organized information practices of the Infor-mation Section and the profession and practices of League of Nations’ journalism can be understood as a co-evolution of journalism, public relations and press work. By the normative guidelines of the “principle of publicity” and the concept of “open diplomacy” media-mediated public communication, preferably via the press, was defined as an important factor for the legitimization of the organization and politics of the League of Nations.
Editorship
Yvonne Dudzik, Andy Räder und Denise Naue (Hrsg.):
Uwe Johnson: Der 5. Kanal. Rostocker Ausgabe.
Berlin: Suhrkamp Verlag 2024;
ISBN print 978-3-518-42716-3.
Der 5. Kanal enthält 99 Rezensionen zum DDR-Fernsehen, die Uwe Johnson zwischen dem
4. Juni und 3. Dezember 1964 für den West-Berliner Tagesspiegel verfasst hat. Im Gegenzug druckte Der Tagesspiegel das Fernsehprogramm der DDR ab. Johnson brachte mit seiner Rezen-sionstätigkeit somit ein in den Zeitungen der BRD und West-Berlins zu dieser Zeit marginalisier-tes Thema ins öffentliche Bewusstsein: das DDR-Fernsehen. Die Kritiken zielen auf verschie-denste Sendungen, Formate und Filme. Das Spektrum reicht von der Magazin-Sendung Prisma, die über alltägliche wie besondere Schwierigkeiten in der DDR berichtete, über den politisch gefärbten Umgang der Sendung Der schwarze Kanal mit Ausschnitten aus dem BRD-Fernsehen bis hin zur Puppenfigur des Sandmännchens. Johnson liefert vor dem Hintergrund der Fernsehkonkurrenz von DDR und BRD einen anderen Einblick in die Zeitgeschichte. Er erweist sich dabei als genauer Beobachter und als scharfzüngiger Kritiker. — Der 5. Kanal erscheint als zweiter Band der Reihe Schriften in der Uwe Johnson-Werkausgabe (Rostocker Ausgabe). 1987 wurden die Rezensionen schon einmal posthum als Buch herausgebracht. Mit dem neu edierten, reichhaltig kommentierten Band kön-nen Leserinnen und Leser nun erstmals gesammelt nachvollziehen, auf welche Sendungen und Filme sich Johnson bezieht und was diese ausmachte.
Rezension: Mark Siemons, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 05.01.2025, Nr. 1, S. 39. [pdf]
Editorship
Grit Lemke und Andy Räder (Hrsg.):
Sorbische Filmlandschaften. Serbske filmowe krajiny.
Berlin: Bertz + Fischer Verlag 2024 (inkl. 2 DVDs);
ISBN print: 978-3-86505-424-1.
Inhaltsverzeichnis (pdf)
Einleitung (pdf)
Seit Filme gemacht werden, stehen auch Sorbinnen und Sorben vor und hinter der Kamera. Einen Höhepunkt erlebte der sorbische Film in der DDR, vor allem in der DEFA-Produktionsgruppe »Sorbischer Film« (Serbska filmowa skupina). In der deutschen Filmgeschichtsschreibung aber ist er bisher nahezu unsichtbar. In Kooperation mit dem Sorbischen Institut schließt die Mono-grafie mit Beiträgen sorbischer und deutscher Autorinnen und Autoren diese Lücke. Vom Kaiser-reich bis in die Gegenwart geben sie einen Überblick des sorbischen Filmschaffens. Der Schwer-punkt liegt dabei auf den Kino- und Fernsehproduktionen des DEFA-Studios sowie der Babelsberger Filmhochschule zwischen 1946 und 1992. Ergänzend dazu werden die wichtigsten sorbischen Filmschaffenden der DDR vorgestellt und ihre Bedeutung für den sorbischen und deutschen Film erörtert. Einzelbeiträge beleuchten zudem Fragen von Identitätsbildung und Film, Literaturverfilmungen, Stereotypen im Film und Verbindungen zum indigenen Kino. Ein Gespräch mit ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Produktionsgruppe bietet seltene Einblicke in eine bislang unbekannte Produktionspraxis und den Umgang mit der einzigen staatlich anerkannten ethnischen Minderheit der DDR. Auf zwei beigelegten DVDs werden wichtige Werke – sowohl deutsch- als auch sorbischsprachig – erstmals öffentlich zugänglich gemacht.
Book Chapter
Andy Räder:
East German Documentary Films by and about Sorbs.
In: Seán Allan und Sebastian Heiduschke (Hrsg.):
Documenting Socialism. East German Documentary Cinema.
Oxford/New York: Berghahn Books 2024, S. 209-234;
ISBN print: 978-1-80539-657-4.
https://doi.org/10.3167/9781805396574
More than 30 years after the collapse of the German Democratic Republic, its cinema continues to attract scholarly attention. Documenting Socialism moves beyond the traditionally analyzed feature film production and places East Germany’s documentary cinema at the center of history behind the Iron Curtain. Covering questions of gender, race and sexuality and the complexities of diversity under the political and cultural environments of socialism, the specialist contributions in this volume cohere into an introductory milestone on documentary film production in the GDR.